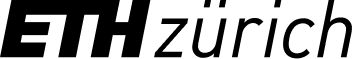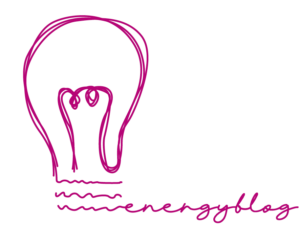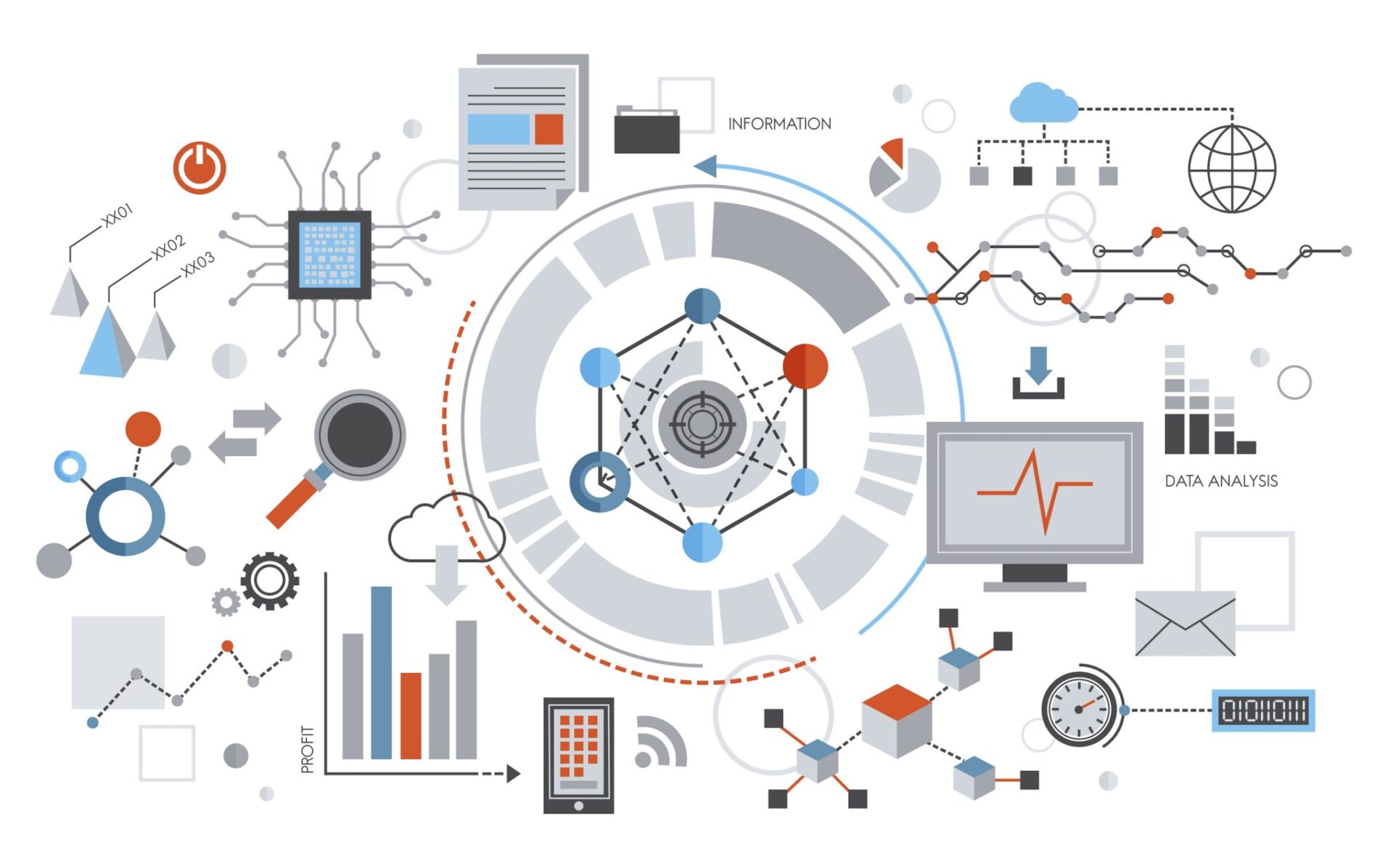Am Energy Data Summit, der im Rahmen der Energy Week @ ETH 2023 stattfand, diskutierten die Teilnehmer die zentrale Rolle von offenen Energiedaten für die Energiewende in der Schweiz. Unser Blog erörtert die wichtigsten Erkenntnisse des Gipfels, darunter die Bedeutung von Energiedaten, den aktuellen Stand offener Energiedaten in der Schweiz sowie die bestehenden Herausforderungen und möglichen Lösungen. Viel Spaß!
In der ersten Dezemberwoche wird die Energie-Wissenschaftszentrum beherbergte die Energiewoche @ ETHeine Veranstaltung, die sich mit einigen der dringlichsten Fragen der Energiewende in der Schweiz befasst.
Die Daten wurden auf der ersten Energie-Daten-Gipfeldie gemeinsam mit dem Energiedaten-Hackdaysmit Teilnehmern aus der Industrie, dem akademischen Bereich und der Regierung. Während der Veranstaltung wurden die Bedeutung von Daten für die Schweizer Energiewende, der aktuelle Stand offener Energiedaten in der Schweiz, bestehende Herausforderungen und mögliche nächste Schritte zu deren Bewältigung diskutiert. Wir fassen hier die wichtigsten Erkenntnisse des Energiedatengipfels zusammen. Viel Spaß!
Was genau meinen wir mit offenen Energiedaten?
Energiedaten beziehen sich auf Statistiken, Messungen und andere Informationen zu verschiedenen Aspekten der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs. Offene Energiedaten beziehen sich auf Energiedaten, die offen verfügbar und öffentlich zugänglich sind und in der Regel in einer strukturierten und maschinenlesbares Format. Beispiele für Energiedaten können sein: Verbrauchsdaten, Stromerzeugung und Handelsvolumen, Wärmebedarf von Industrie und Haushalten, Fahrverhalten von Fahrzeugen, Solar-, Wind- und andere Ressourcenpotenziale sowie Energiemarktdaten wie Preise, Investitionskosten und Subventionen.
Warum brauchen wir Daten für die Schweizer Energiewende?
Erstens verbessern Daten das Verständnis von Energieerzeugungs- und -verbrauchsmustern und bieten Einblicke sowohl für den Betrieb als auch für die Planung der Entwicklung von Energiesystemen. Echtzeit-Verbrauchsdaten ermöglichen es den Energieversorgern, die Stromnachfrage zu verstehen und zu prognostizieren und somit die Effizienz ihres Betriebs zu verbessern. Auch für Kantone, Gemeinden und Energieversorger sind die Daten ein entscheidender Faktor, da sie es ihnen ermöglichen, fundierte und kontextgerechte Investitionsentscheidungen für die Energieinfrastruktur zu treffen. Der örtliche Energieversorger in Höfe verfügt beispielsweise über Echtzeitdaten von intelligenten Zählern aller Verbraucher und nutzt diese, um Entscheidungen über die Entwicklung der Infrastruktur zu treffen, wobei er sich auf beobachtete Trends stützt - wie die Nutzung von Elektroautos und die Installation von Wärmepumpen. Nach Angaben von Arne Kähler, dem Geschäftsführer von EW HöfeOhne Daten werden wir die Herausforderungen der Zukunft im Energiesektor kaum meistern können.
Zweitens fördert die Zugänglichkeit der Daten den Wettbewerb und den Vergleich zwischen den Verbrauchern, seien es Haushalte, Gemeinden oder Kantone. Wie Philipp Schütz, Professor an der HSLUEin wichtiger Antrieb für die Umsetzung könnte [...] der soziale Wettbewerb sein - bin ich besser oder schlechter als mein Nachbar? Beispielsweise können Haushalte, die mit intelligenten Zählern ausgestattet sind, ihre Energieverbrauchsmuster leicht verfolgen und vergleichen, was zu dem Wunsch führen könnte, die Praktiken ihrer Nachbarn zu übertreffen oder zumindest anzugleichen. Auf breiterer Ebene können Gemeinden und Kantone die Verfügbarkeit von aggregierten Energiedaten nutzen, um ihre Leistungen mit denen benachbarter Regionen zu vergleichen. Diese Art der vergleichenden Analyse liefert wertvolle Einblicke in bewährte Verfahren und verbesserungswürdige Bereiche des Energiemanagements und der Energieerzeugung.
Schließlich unterstützen Daten aus der Praxis verschiedene Forschungsaktivitäten, die sich auf die Gestaltung zukünftiger Energiesysteme und -märkte konzentrieren. Eines der auf dem Gipfel heftig diskutierten Themen ist beispielsweise die Idee, das Verbrauchsverhalten durch dynamische Stromtarife in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Solarstrom zu beeinflussen. Die akademische Forschung könnte dazu beitragen, die Möglichkeiten und Auswirkungen von Tarifgestaltungsoptionen zu verstehen, allerdings nur, wenn stündliche Stromverbrauchsdaten verfügbar sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Daten Trends aufzeigen und für Transparenz sorgen; beides wiederum führt zu Erkenntnissen, die bei der Entscheidungsfindung helfen und Innovationen vorantreiben.
Wie ist der Stand der offenen Energiedaten in der Schweiz?
Die verschiedenen Akteure des Energiesektors in der Schweiz - Industrie, Wissenschaft und die Regierungen von Bund, Kantonen und Gemeinden - bewegen sich langsam in Richtung offener Energiedaten. Allerdings gibt es nach wie vor mehrere Hindernisse für die Beschaffung vollständiger und zuverlässiger Daten.
Die größte Herausforderung ist die Tatsache, dass Energiedaten von öffentlichem Interesse oft nicht öffentlich zugänglich sind und die gemeinsame Nutzung aufgrund von fehlendem Know-how und Standards, Datenschutzproblemen und einem allgemeinen Mangel an Anreizen schwierig ist. Matthias Galus, Leiter Geoinformation & Digitale Innovation beim Bundesamt für Energie (BFE), erläutert, woran das liegen könnte: "Wir haben keine expliziten Anforderungen oder einen regulatorischen Rahmen, der offene Energiedaten vorschreibt, wer was veröffentlichen sollte. Auch gibt es keine Anreize für Energieunternehmen oder Netzbetreiber. [...] Dann kommt der Datenschutz als praktisches Argument ins Spiel, um Daten nicht zu teilen, ohne dass man sich die Mühe macht, zu analysieren, was tatsächlich möglich ist."
Die zweite Herausforderung besteht darin, dass "Daten vorhanden sind, aber der Datenaustausch nicht so gut oder gar nicht funktioniert", wie Nicolas Lanz, Leiter der Energieversorgung des Kantons Bern, und mehrere andere Gipfelteilnehmer betonten. Selbst wenn Daten verfügbar sind, ist der Austauschprozess oft ineffizient und schlecht organisiert, was für die Datenlieferanten einen erheblichen Aufwand bedeutet. Zudem sind die Daten selbst von uneinheitlicher Qualität, was zu einem hohen Verarbeitungsaufwand für die Nutzer führt.
Ein Vergleich der Schweiz mit den europäischen Ländern zeigt auch eine bemerkenswerte Lücke in der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Daten. Die Diskussionen auf dem Gipfel wiesen auf zwei Hauptfaktoren hin, die zu dieser Diskrepanz beitragen: In der Schweiz gibt es so viele Akteure, dass die Koordinierung eine Herausforderung sein kann - es gibt allein mehr als 600 Stromversorgungsunternehmen, denen es an Anreizen und/oder Mandaten für den Datenaustausch fehlt. Im Gegensatz dazu gibt es in der EU seit langem Vorschriften und Anforderungen für gemeinsame Datennutzungviele davon wegen ihrer Elektrizität Marktliberalisierung.
Auch wenn die Schweiz bei der gemeinsamen Nutzung von Daten noch nicht so weit ist, hat sie doch wichtige Fortschritte gemacht. Hier sind ein paar Beispiele:
- Die Bundesverwaltung, die Kantone und die Gemeinden tauschen aktiv Daten aus, zum Beispiel über opendata.swiss oder über ihre eigenen Plattformen, wie in Die Energieplattform des Kantons Bern. Andere relevante Datenquellen sind das Gebäude- und Wohnungsregister des Statistischen Bundesamtsmit Informationen über alle bestehenden Gebäude und ihre Heizungsart; Stromtarife der ElCom; und die BFE's Energie-Dashboard Überwachung von Echtzeit-Energiemarktdaten.
- Mehrere Unternehmen tauschen Daten aus, darunter auch Swissgrid: Swissgrid bietet eine EnergieübersichtCKW bietet Smart-Meter-Daten; und TNC-Beratung bietet Schweizer Energie-Charts und veröffentlicht Strommarktdaten.
- Im akademischen Bereich haben sich die Schweizer Universitäten der Nationale Strategie für offene Forschungsdaten in der Schweizund setzt sich für die Offenheit aller in der Forschung erzeugten Daten ein. Forscher veröffentlichen Daten auf verschiedenen Plattformen wie zenodo, Yareta von der Universität Genf, Sammlung ETH-Forschung, neidisch oder CROSSDateine Plattform mit Energieforschungsdaten, die im Rahmen des Projekts SWEET-Förderprogramm vom BFE.
Wie können wir in der Schweiz zu offenen Energiedaten kommen?

Abbildung 1: Unsere Neujahrsvorsätze zu offenen Daten in der Schweiz. Entworfen von Freepik
Die Wunschliste für offene Energiedaten in der Schweiz variiert je nachdem, wen man fragt (Abbildung 1). Wir können sie jedoch auf 4 zentrale Empfehlungen zusammenfassen:

Wir müssen beginnen mit gemeinsame Nutzung der vorhandenen Daten-das muss pronto geschehen. Ein wesentlicher Aspekt dieses Vorhabens ist Festlegung von Datenstandards. Florin Hasler aus Opendata.ch hervorgehoben: "Datenstandards erhöhen die Interoperabilität und verbessern die Datenqualität. Dies führt zu einer höheren Effizienz des Datenaustauschs und zu einer Senkung der damit verbundenen Kosten."

Wir brauchen einen Prozess Aufklärung sowohl der Energieversorger als auch der Verbraucher wie intelligente Zählerdaten genutzt werden können. Während sich die Schweizer Regierung auf die Einführung von intelligenten Zählern konzentriert und bis 2027 eine Abdeckung von 80% anstrebt, wird die Sensibilisierung für die Vorteile und Möglichkeiten, die durch intelligente Zählerdaten ermöglicht werden, dazu beitragen, dass die Daten effektiv genutzt werden.

Erweitern wir unseren Blickwinkel über die Elektrizität hinaus. Offene Daten in allen Energiesektoren - einschließlich Heizung, Industrie und Verkehr - werden uns helfen, umfassende Wege zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität zu verstehen und umzusetzen.

Aufbau eines soliden Governance-Rahmens ist unerlässlich, um die Komplexität des digitalisierten Energiesektors zu bewältigen. Klarheit über die Zuständigkeiten und die Verwendung der Daten ist von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen in den Datenaustausch zu fördern. Der rechtliche Rahmen ist die eine Sache, aber dann muss sich oft auch die Kultur [zwischen allen Beteiligten] ändern", sagte Cornelia Kawan von ElCom.
Eindrücke vom Energiedatengipfel
























Bilder von Matthias Eifert, Samuel Renggli und Adriana Marcucci