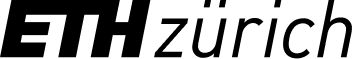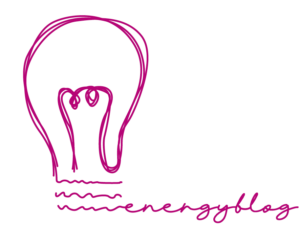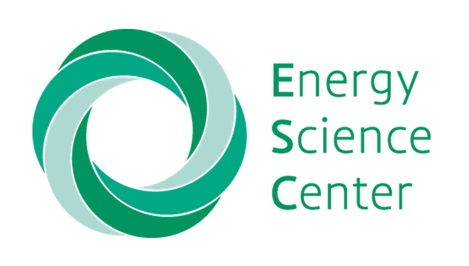Seit den 1960er Jahren hat Japan seine Kernkraftindustrie aggressiv aufgebaut, um zu den besten der Welt zu gehören. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 hat dies alles verändert. Heute kämpfen die etablierten Atomkraftwerke in Japan im Wettbewerb mit den schnell wachsenden erneuerbaren Energien um politische Unterstützung und Anteile an der Stromversorgung.
In Japan ist die Kernenergie seit langem der "saubere" Energiestandard für einen isolierten Inselstaat, der zur Deckung seines Energiebedarfs stark von der Einfuhr fossiler Brennstoffe abhängig ist. Diese Abhängigkeit von externen Ressourcen hat zu tiefgreifenden geopolitischen Interdependenzen geführt, die nicht nur Japans Energiestrategien im Ausland, sondern auch im eigenen Land geprägt haben. Die Kernkraft sollte anders sein, und sie war und ist in vielerlei Hinsicht immer noch eine Säule der japanischen Energiestrategie und Energiepolitik. Im Jahr 2010 stammten 25% des gesamten erzeugten Stroms aus der Kernenergie, und es wurde erwartet, dass dieser Anteil bis 2017 auf 40% steigen würde. Im Jahr 2011 wurden jedoch vier der sechs Kraftwerke der Tokyo Electric Power Company (TEPCO) in Fukushima Daiichi beschädigt, als ein 15 Meter hoher Tsunami nach dem Erdbeben vom 11. März die Stromversorgung und die Kühlung lahmlegte. Kurz darauf schaltete Japan alle 54 betriebsbereiten Kernreaktoren an knapp zwei Dutzend Standorten ab - fast 22% der Stromversorgung gingen in einem einzigen Ereignis verloren.
In den darauffolgenden Jahren kämpften die japanische Zentralregierung und die Energieversorgungsunternehmen darum, die Stimmung für die Kernenergie aufrechtzuerhalten, aber heute ist die Lage etwas differenzierter. Erneuerbare Energien haben das Spielfeld betreten, und ein kürzlich eingeführter Plan zur Kohlenstoffneutralität bis 2050 verlangt einen höheren Anteil an sauberer Energie. Die Kernenergie hat es schwer, sich durchzusetzen und kämpft mit Kostenbarrieren, Sicherheitsunsicherheiten und schwankender öffentlicher Unterstützung. Dennoch ist der Abbau der japanischen Nuklearinstitutionen keine leichte Aufgabe - gelinde gesagt, müssen sich die Befürworter der erneuerbaren Energien anstrengen.
Vor dem Erdbeben von 2011 machten die erneuerbaren Energien ohne Wasserkraft (~7%) weniger als 3% der gesamten Stromerzeugung aus, und der Rest wurde durch fossile Brennstoffe und Kernenergie bereitgestellt. Im Jahr 2014 sank der Anteil der Kernenergie dann auf 0%. Die Frage lautete also: Wie lässt sich die fehlende Lücke am besten schließen? Es überrascht nicht, dass die erneuerbaren Energien als langfristige Lösung angepriesen wurden, da sie eine hohe Kapitalrendite und einen hohen Umweltnutzen versprachen.
Zwei wichtige politische Maßnahmen ermöglichten den raschen Ausbau der japanischen EE-Produktion: eine Einspeisevergütung (FiT) und die vollständige Liberalisierung des Strommarktes. Im Jahr 2012 führte Japan eine Einspeisevergütung ein, die Investitionen in erneuerbare Energien förderte, indem sie den EE-Unternehmen garantierte, dass die regionalen Stromversorger ihren Strom zu einem festen Mindestsatz abnehmen würden. In der Folge stiegen die Investitionen in Solarenergiesysteme stark an. In Verbindung mit dem neu liberalisierten Energiemarkt (2016) ermöglichte die FiT Tausenden von großen und kleinen Unternehmen, Strom aus erneuerbaren Energien auf dem Markt zu verkaufen. Vor Fukushima wurde die Energiepolitik Japans weitgehend von zehn regionalen Energieversorgern und einer Reihe großer Kohle-, Atom- und Wasserkraftwerke diktiert. 2019 befanden sich 69 TWh Solarenergie im Besitz von Tausenden von EE-Anbietern und wurden von diesen betrieben. Heute machen EE 18% der gesamten Stromversorgung Japans aus.
Trotz des Aufstiegs der erneuerbaren Energien und der Anti-Atomkraft-Reaktion zahlreicher anderer Kernkraftnationen, wie der Schweiz, Deutschland, Belgien, Südkorea und Taiwan, haben Japans Energiepolitiker und die Zentralregierung eine nukleare Einführungsphase statt einer Strategie zur Wiederherstellung des Ausstiegs. Die Kernkraft kehrte 2015 ans Netz zurück, und derzeit sind neun Reaktoren wieder in Betrieb, sieben erfüllen mindestens einen der drei für die Wiederinbetriebnahme erforderlichen Schritte der NRB, und neun weitere Reaktoren haben einen Antrag auf Genehmigung gestellt. Im Jahr 2019 stammen 6,2% der japanischen Stromversorgung aus der Kernenergie.
Finanziell gesehen ist dieser Ansatz seltsam. Im Jahr 2020 beliefen sich die Gesamtkosten seit dem Erdbeben für die Umsetzung neuer staatlich vorgeschriebener Sicherheitsvorschriften, die Wartung und den Betrieb sowie die Stilllegung von Kernkraftwerken auf fast 13,5 Billionen Yen (~115 Mrd. CHF). In einem Interview Ende Januar erklärte der ehemalige Premierminister Naoto Kan, dass die Installation neuer Kernkraftwerke heute dreimal so teuer ist wie vor dem Erdbeben. Die Energiebehörden schätzen, dass Atomstrom wahrscheinlich 15 Yen/kWh kosten wird, verglichen mit Strom aus erneuerbaren Energien, der nur 5 Yen/kWh kostet. Grundsätzlich glaubt Kan, dass es finanziell unmöglich sein wird, Kernkraftwerke in Betrieb zu halten, geschweige denn neue zu installieren.

Nur zehn Minuten östlich der Stadt Namie wurde im März 2020 die weltweit größte hochmoderne Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff, das Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R), fertiggestellt. Foto von Andrew Faulk (www.andrewfaulk.com)
Es scheint, dass politische Zweckmäßigkeit oft die finanzielle Logik übertrumpft. Wie Daniel Aldrich, Professor für Politikwissenschaft an der Northeastern University, feststellt, "herrscht in der japanischen Bürokratie eine gewisse technokratische Arroganz". Obwohl der "Fukushima-Effekt" Aktivisten im Ausland mobilisiert hat, sich für eine atomfreie Energiepolitik einzusetzen, hält Japan fest an seinen tief verwurzelten institutionellen Autoritäten fest, die die Kernenergie befürworten. In der Literatur und in der Politik als "Nukleares Dorf" bekannt, hat die Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI), den Atomkraftunternehmen und der seit langem regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) ein Umfeld geschaffen, in dem die japanische Energiepolitik unangefochten kontrolliert wird. Kan behauptet, dass das Nukleardorf in den letzten zehn Jahren erheblich an Macht verloren hat, obwohl es immer noch enormen Einfluss auf die Förderung der Atomindustrie hat.
Interessanterweise hält die finanzielle Unmöglichkeit, die Kernenergie aufrechtzuerhalten, das Dorf jetzt davon ab, sie direkt zu unterstützen. Stattdessen hat man sich darauf verlegt, die EE zu verteuern. Kan besteht erneut darauf, dass diese Bemühungen scheitern werden. Die EE sind einfach zu billig, um sie zu ignorieren. Derzeit investiert Kan seine gesamte politische "Energie" in die Förderung der Solarenergie. Er glaubt, dass dies die neue Normalität sein wird - die Zukunft von Japans Energiesystem. Kan ist insbesondere ein starker Befürworter des "Solar-Sharing", also des Konzepts, dass sich Pflanzen und Solarzellen das Land und das Sonnenlicht teilen. Japanische Landwirtschaftsverbände haben sich gegen die Ausweitung von Mega-Solarparks ausgesprochen, da diese die begrenzten Ressourcen des Landes gefährden. tanboAckerland. Solar-Sharing könnte ein Ausweg sein. Wird das funktionieren? Auf die Frage, wie man die politische Unbeliebtheit umgehen kann, um die Entwicklung von EE-Technologien voranzutreiben, antwortete Kan scherzhaft: "Sagen Sie es mir". Kan hat Solarzellen auf dem Dach seines Hauses in Tokio installiert. "Wir müssen durch Vorzeigen überzeugen", sagt er.
Was bedeutet dies nun für die Energiezukunft Japans?
Der neu ernannte Premierminister Suga kündigte im Oktober 2020 den Plan Japans an, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden. Während die Einzelheiten dieses Plans für Mitte 2021 zu erwarten sind, werden die derzeitigen 5th Der Energiestrategieplan sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 20-22% der Elektrizitätsversorgung aus Kernenergie stammen sollen. Dies erfordert nicht nur die Wiederinbetriebnahme aller bestehenden betriebsfähigen Anlagen, sondern auch den Bau neuer Anlagen.
Ist das Wahnsinn oder ein vernünftiger Ansatz zur Emissionssenkung? Meiner Meinung nach ist die Erreichung des Ziels der Kohlenstoffneutralität 2050 in Japan vor allem eine Frage der Unterstützung von EE-Technologien in der Übergangsphase. Der Schlüssel dazu ist, sie billig zu machen und sie schnell zu verbreiten. Wenn die Kernenergie aus bestehenden Anlagen eine saubere Lösung für die Grundlastversorgung in dieser Übergangsphase bietet, sollten wir nicht voreilig urteilen. Langfristig ist es jedoch sowohl wirtschaftlich töricht als auch ökologisch gefährlich, den Ausbau der Kernkraft im Gegensatz zur EE-Industrie zu unterstützen.
Langfristig gesehen besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich Naturkatastrophen wiederholen. Dies ist äußerst besorgniserregend. In seinen Memoiren beschreibt Premierminister Kan die Ereignisse von 2011 und die Unmöglichkeit, eine Evakuierungsstrategie für 50 Millionen Menschen zu entwickeln, wenn die Stadt Tokio evakuiert werden müsste. Das Kraftwerk TEPCO Daiichi war nicht weit von einer solchen Katastrophe entfernt. Wie man auf Japanisch sagen würde, war es Girigiri-gerade noch. Der Vorfall in Fukushima bedrohte die Existenz einer ganzen Nation. Wer diese Tatsache ignoriert, hat keinen Bezug zur Realität.
If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!